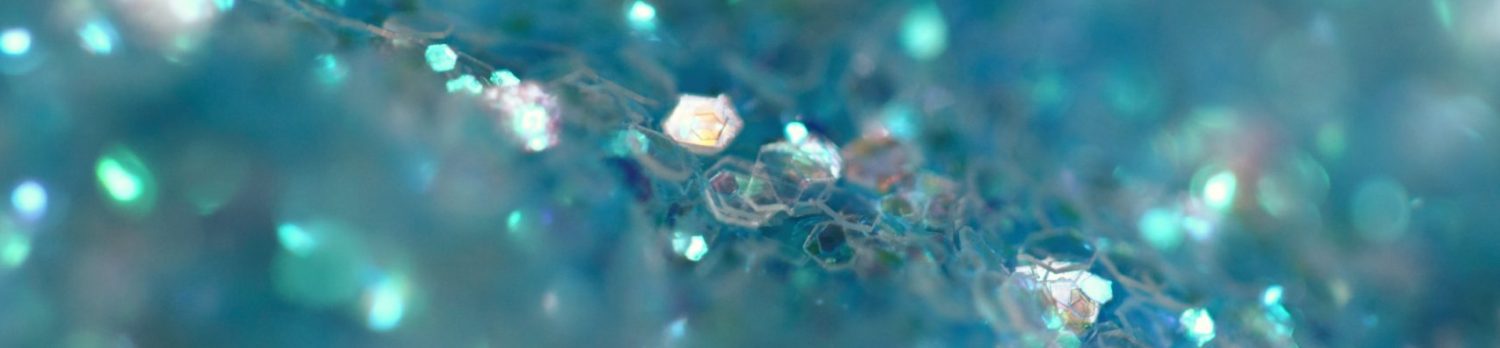Die Patientin kommt ins Sprechzimmer und der Ärztin ist sofort klar, was ihr fehlt. Das Labor bestätigt den Verdacht, die Patientin freut sich über die schnelle Diagnose und die Ärztin klopft sich insgeheim für die korrekte Blickdiagnose auf die Schulter.
Die Kunst der Blickdiagnose erfordert viel Erfahrung und sorgfältiges Abwägen von Urteilen – sonst verleitet sie zum Vorurteil und steht alternativen Hypothesen im Weg. Die ärztliche und menschliche Urteilskraft ist gefragt.
Ist sie das wirklich? Oder können auch ausreichend verfeinerte Algorithmen Blickdiagnosen stellen? Auch Algorithmen können schließlich die Einzelheiten und Proportionen eines Bildes analysieren und sie mit vorhandenen Datensätzen vergleichen, so wie ein menschlicher Kollege zur Diagnose auf die Datensätze seiner klinischen Erfahrung zurückgreift.
Hinzu kommt: Ein Computer kann in kurzer Zeit so viele Datensätze analysieren, wie ein Mensch sie niemals im Laufe eines einzigen Berufslebens sammeln – geschweige denn im Gedächtnis präsent haben – könnte. Einem Computer steckt nie der letzte Nachdienst in den Knochen, und er lässt sich nicht von einem vollen Wartezimmer unter Stress setzen.
Die App Face2Gene diagnostiziert anhand von Patientenfotos seltene genetische Erkrankungen. Wird die automatisierte Gesichtserkennung in Zukunft menschliche Experten und die gerade boomende Genomsequenzierung ersetzen oder ergänzen?
Die Frage, ob auch ein Computer zur Blickdiagnose in der Lage ist, beantworten die Wissenschaftler der US-amerikanischen Firma FDNA mit einem klaren „Ja“. Sie haben die Software-Suite Face2Gene entwickelt, die anhand von Patientenfotos Diagnosen seltener genetischer Erkrankungen stellt.
Das Dilemma der genetischen Diagnostik: Wir kennen um die 20.000 Gene des Menschen und viele tausend genetisch bedingte Erkrankungen. Wenn nun Defekte in je einem Gen genau eine Erkrankung auslösen würden, wäre die Welt einfach. In Wirklichkeit werden aber genetische Erkrankungen auch von Defekten in verschiedenen Genen ausgelöst, und unterschiedliche Defekte in einem einzigen Gen verursachen verschiedene Erkrankungen.
Aber, so könnte man denken, glücklicherweise haben wir doch das menschliche Genom vollständig entschlüsselt. Es besteht der Verdacht auf eine genetische Erkrankung bei einem Patienten? Sequenzieren wir ihn doch!

Das ist nicht ganz so einfach: Zunächst einmal ist die DNA-Sequenzierung immer noch keine preiswerte Untersuchungsmethode, obwohl die Preise in den letzten Jahren deutlich gefallen sind. Mit den diversen Methoden des sogenannten Next Generation Sequencing (NGS) kostet die Sequenz eines kompletten menschlichen Genoms im günstigsten Fall knapp über 1000 EUR oder US-Dollar. Zugegeben: Ein Schnäppchen im Vergleich zu den 2,7 Milliarden US-Dollar, die die erste vollständige Sequenzierung des Menschen gekostet hat. Es kommen aber noch weitere Kosten hinzu: Die Rohdaten müssen von Bioinformatikern analysiert und in eine menschenlesbare Form gebracht werden. Dann – der vielleicht wichtigste Schritt der Analyse – muss gründlich ausgemistet werden: Jeder von uns trägt mehrere 100.000 genetische Abweichungen vom Referenzgenom in sich, von denen natürlich die allerwenigsten zu einer Erkrankung führen. Selbst, wenn man nur Varianten weiter anschaut, die in der Bevölkerung sehr selten sind, bleiben oft über hundert in einem einzelnen Patienten übrig. Wenn man – wie es oft noch üblich ist – nicht das ganze Genom sequenziert hat, sondern nur die proteincodierenden Anteile, das Exom, dann sind diese Zahlen nur wenig geringer.
Fast immer bleiben also nach der Genomanalyse eines Patienten Dutzende von Mutationen übrig, von denen nur eine oder zwei tatsächlich für die Erkrankung ursächlich sind. Hier beginnt das Kopfzerbrechen: Liegen die Mutationen in Genen oder dazwischen? Welche der Gene, in denen eine Mutation liegt, haben überhaupt bekannte Funktionen? Spielen irgendwelche dieser Gene eine Rolle in wichtigen Stoffwechselwegen? Ist vielleicht schon einmal ein Patient mit einer Mutation in diesem Gen beschrieben worden? Und: Hat die Mutation überhaupt einen Einfluss auf die Funktion des Gens, oder ist sie völlig harmlos?
Es vergeht also viel teure Arbeitszeit, bis man sich auf eine Handvoll Genkandidaten geeinigt hat, die als Verursacher der Krankheit eines Patienten in Frage kommen. Wenn man in einem dieser Kandidaten die Mutation dann noch mittels einer unabhängigen Methode bestätigen kann (und auch diese kann wieder mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen) – dann ist eine Diagnose zumindest in greifbarer Nähe. Ansonsten steht das Ärzteteam dem Patienten und seiner Familie wieder mit leeren Händen gegenüber.
Schon bevor man das ganze Genom sequenzieren konnte, haben Ärzte natürlich auch den umgekehrten Weg gewählt: Eine sorgfältige Anamnese und Untersuchung verrät in vielen Fällen schon, welche genetischen Defekte in Frage kommen. Bei angeborenen genetischen Syndromen ist oft schon das Gesicht des Patienten besonders vielsagend: Viele Syndrome verraten sich durch eine bestimmte Form von Nase, Augen oder Ohren, durch Asymmetrie oder ungewöhnlich verschobene Proportionen. Ein erfahrener Genetiker kommt also hier mit der Blickdiagnose schon weit und kann die in Frage kommenden Gene im günstigsten Fall auf eins oder zwei eingrenzen.
Im günstigsten Fall, denn: Es sind vor allem die schon lang bekannten und gut erforschten genetischen Erkrankungen, die eine solche Blickdiagnose ermöglichen. Oder anders herum gedacht: Vor einigen Jahrzehnten, als Ärzte noch hauptsächlich anhand des klinischen Bildes diagnostizieren mussten, wurden nur solche Syndrome erkannt, die ein typisches Bild aufwiesen.
Heutzutage ist die Situation komplizierter: Man kennt Familien von Syndromen, die sich im klinischen Bild nur ganz diskret unterscheiden und von Defekten in verschiedenen Mitgliedern von Genfamilien verursacht werden. Und Defekte in Genen, deren Funktion man noch vor einigen Jahren gar nicht kannte, werden als potenzielle Ursachen von Krankheiten mit bisher unbekannter Ursache diskutiert. Das Feld wird also komplexer – so komplex, dass man es nur noch mit Hilfe von unterstützender Technologie beherrschen kann? Und wenn ja, wer unterstützt wen: Ist der Computer entbehrlich oder der Mensch?

Zurück zu Face2Gene: Die App wurde von Programmierern entwickelt, die zuvor an der Gesichtserkennung in Fotos auf Facebook gearbeitet haben. In Face2Gene beschränken sie sich natürlich nicht darauf, ein Gesicht als solches zu erkennen: Es werden vielmehr auch sogenannte Dysmorphien erkannt – in welchem Winkel steigt die Lidachse an? Wie breit ist die Nasenwurzel? Wie sieht der Schwung der Oberlippe aus? All dies wird in einem Koordinaten-Netz festgehalten, das der Computer über das Gesicht legt. Verglichen werden diese Daten dann mit anderen gespeicherten Fällen, teilweise aus der schon lange gebräuchlichen London Dysmorphology Database. Die Ähnlichkeit zu anderen Gesichtern mit bestimmten Syndromen wird in einem Split Screen oder einer Heatmap visualisiert. Anhand der Ähnlichkeit der Gesichtsstrukturen und – wenn der Nutzer zusätzliche Informationen zum Patienten bereitstellt – der Ähnlichkeit des sonstigen klinischen Bildes werden wahrscheinliche Syndromdiagnosen vorgeschlagen.
Bei trotz App-Konsil weiterhin unklaren Fällen bietet Face2Gene an, dass ein Expertenpanel von klinischen Genetikern bei der Diagnose weiterhilft. Zudem gibt es ein Forum, in dem Nutzer sich zu unklaren Fällen austauschen können.
Auch Fälle, bei denen es nie zu einer genetischen Diagnose kommt, können laut FDNA in das Machine Learning einbezogen werden: „When there is only a clinical diagnosis, we have a benchmarking system that applies confidence scores to users and diagnoses so that mistakes are outweighed over time.“
Und wie steht es um den Datenschutz? FDNA sitzen in den USA, sind aber nach eigenen Angaben auch EU-datenschutzkonform. Das Patientenfoto werde, so steht es auf der Webseite, nicht auf den Computern von FDNA gespeichert, sondern bleibe lokal auf dem Handy oder Rechner des Arztes. Nur eine anonymisierte mathematische Beschreibung – das „Netz“, das die Gesichtsstruktur wiedergibt – werde an FDNA übermittelt, so dass eine Anpassung der Einverständniserklärung des Patienten über die Weitergabe seines Bildes nicht notwendig sei.
Fazit: Das Geschäftsmodell von Face2Gene scheint noch etwas unklar. Eine Sprecherin von FDNA dazu: „All FDNA apps are free for healthcare providers. FDNA plans to develop a revenue stream by using its technology to support drug discovery and trial recruitment in the pharmaceutical industry“. Wie gut die Qualitätskontrolle der Fälle und der Datenschutz funktioniert, bleibt noch abzuwarten. Fest steht aber, dass Face2Gene sowohl für Genetiker als auch Nicht-Genetiker ein nützliches Tool zur Entscheidungsunterstützung ist, und Ärzte mit Hilfe der App Patienten und ihren Eltern möglicherweise schon Jahre früher eine definitive Diagnose nennen können – und sei es nur, weil die App den Kliniker auf seltene Erkrankungen hinweist, die vorher gar nicht in Betracht gezogen wurden.