„Gebt mir meine Daten! Patient Empowerment und IT“ – das ist der Titel meines heutigen Vortrags auf dem Symposium „Digitale Medien in der psychischen Versorgung?“ in Köln. Die Forderung stammt aber nicht von mir, sondern vom Patientenaktivisten Dave DeBronkart, auch als e-Patient Dave bekannt. Genauer gesagt ist
Gebt mir meine verdammten Daten!
… nur eine in einer ganzen Reihe von Forderungen, die er aufstellt. Ziel: Patient Empowerment, also die Ermächtigung von Patienten, ihr eigenes Schicksal (und ihre Gesundheitsversorgung) selbst in die Hand zu nehmen.
e-Patients: „electronic“ und „empowered“
DeBronkart hat sich, aufbauend auf seinen eigenen Erfahrungen als Krebspatient, an die Spitze der einst vom Arzt Dr. Tom Ferguson ins Leben gerufenen e-Patient-Bewegung gesetzt. Die e-Patients verstehen sich als electronic und empowered und damit als Gegenentwurf zum traditionell passiven, „leidenden“ Patienten, der die Entscheidungen des Arztes hinnimmt wie das Wort Gottes.
Erst mit dem Einzug von digitalen Medien in die Gesundheitsversorgung, so sagen sie, haben Patientinnen und Patienten die Chance, aktiv an Diagnose und Therapie teilzuhaben: Während medizinisches Wissen jahrhundertelang in Bibliotheken gehütet wurde, die nur Experten zugänglich waren, lassen sich heute mehr (gute und, zugegebenermaßen, schlechte) medizinische Informationen googeln, als ein Einzelner jemals konsumieren kann.
In eine ähnliche Richtung gehen seine anderen Forderungen an die Medizin in seinem Manifest „Let Patients Help!“ (auf Deutsch abgedruckt in „Gesundheit 2.0“ von Andréa Belliger und David J. Krieger) – hier eine kleine Auswahl:
Lasst Patienten mithelfen, die Welt nach Informationen zu durchforsten!
Denn: Kein Arzt kann Experte für alle Krankheiten sein, aber fast jeder Patient kann zum Experten für seine Krankheit werden.
Lasst Patienten bei Qualität und Sicherheit mithelfen!
DeBronkart zitiert dazu viele Beispiele von Fehlern und Fast-Fehlern, die nur deshalb Patient/Patientin nicht die (restliche) Gesundheit oder das Leben gekostet haben, weil er, sie oder die Angehörigen sich eigenständig informiert haben.
Lasst Patienten mithelfen, Forschungsprioritäten zu setzen!
Patienten sind nun mal keine großen Drittmittel-Geber, deshalb bilden sich die Patientenpräferenzen erst über zwei oder drei Ecken (oder auch: gar nicht) in Forschungsprioritäten von Universitäten und Industrie ab.
Fazit: Mehr Rechte für Patient_innen – und alles wird besser? Die Sache ist, wie meistens im Leben, dann doch nicht so einfach.
Information: Je mehr desto besser! (Wirklich?)
Frage 1: Ist es für Patient_innen immer gut, uneingeschränkt über ihre eigenen Daten Bescheid zu wissen? Das ist die Frage des sogenannten therapeutischen Vorbehalts. Diesen hat man in der Vergangenheit oft viel zu weit getrieben – so weit, dass man es absolut vermieden hat, schwer erkrankte Patiente rechtzeitig über die Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung aufzuklären und ihnen somit die Möglichkeit genommen hat, vor ihrem Tod in Ruhe ihre Angelegenheiten zu regeln.
 Aber trotzdem ist die Frage berechtigt: Kann man die negativen Auswirkungen, die die Mitteilung einer schwerwiegenden Diagnose hat, irgendwie abmildern? Sollte man dem Patienten die Information häppchenweise zukommen lassen – oder gleich „reinen Tisch“ machen?
Aber trotzdem ist die Frage berechtigt: Kann man die negativen Auswirkungen, die die Mitteilung einer schwerwiegenden Diagnose hat, irgendwie abmildern? Sollte man dem Patienten die Information häppchenweise zukommen lassen – oder gleich „reinen Tisch“ machen?
Das Problem ist, dass Patient_innen so vielfältig sind, dass man keine richtige Antwort auf diese Frage geben kann. Einige möchten – zu Recht – alle Fakten über die eigene Erkrankung haben, die auch die Ärztin hat. Andere googeln ihre Symptome, wieder andere wollen stets eine Zweitmeinung. Und nicht wenige Patienten möchten es gar nicht so genau wissen – und möchten auch ungern damit belastet werden, mitentscheiden zu müssen. „Was würden Sie denn machen, Frau Doktor?“
So lange jeder Patient selbst weiß, in welche Gruppe er gehört, ist alles gut: Die, die wissen wollen, dürfen wissen – und die, die nicht wissen wollen, müssen nicht wissen.
 Leider hat die Patientin als gleichberechtigte Partnerin noch keine lange Geschichte im Gesundheitswesen vorzuweisen. Deshalb ist es vielen Patient_innen noch nicht bewusst, das man hier überhaupt eine Entscheidung für oder gegen das Wissen treffen kann – und muss.
Leider hat die Patientin als gleichberechtigte Partnerin noch keine lange Geschichte im Gesundheitswesen vorzuweisen. Deshalb ist es vielen Patient_innen noch nicht bewusst, das man hier überhaupt eine Entscheidung für oder gegen das Wissen treffen kann – und muss.
Vor allem Patient_innen, die mit einer schwerwiegenden Diagnose konfrontiert sind, glauben manchmal, sie wollten alle Informationen haben – aber in Wirklichkeit suchen sie nur selektiv Informationen, die die Diagnose widerlegen könnten.
Umgekehrt gibt es – vor allem bei den älteren Semestern – immer noch viele, die mit dem Klischee des Arztes als Halbgott in Weiß groß geworden sind und sich nicht so recht trauen, Informationen zu fordern – obwohl sie mit diesen durchaus klarkommen würden und sie sogar nutzen könnten, um mit ihrer Krankheit besser umzugehen.
Also? Nein, es ist nicht immer gut für Patient_innen, maximal viel über ihre Erkrankungen zu erfahren. Aber es ist immer gut, sie vor die Wahl zu stellen und ihnen nach bestem Wissen zu helfen, die oben genannten Fallstricke zu umgehen.
Wo kann der Patient die Informationen aufbewahren?
Frage 2: Wie schaffen wir es logistisch, jedem Patienten potenziell alle Informationen zur Verfügung zu stellen?
Eine Binsenweisheit: Niemand im Gesundheitswesen hat Lust auf noch mehr Bürokratie. Selbst sogenannte Assistenzberufe sind so überlastet, dass sie selbst schon wieder Assistenten bräuchten. Wie soll man da jemanden finden, der 1.) Zeit hat, 50 Seiten Patientenakte zu kopieren und 2.) auch noch der Schweigepflicht unterliegt?
Klar, das können wir alles digital machen. Es steht auch so im BGB (§ 630 g Abs. 2):
Der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen.
Bei vielen Arten von Patientendaten – beispielsweise genetischen – ist eine andere als die elektronische Speicherung auch gar nicht mehr möglich, des Umfangs wegen.
Aber sobald die Patientin das Krankenhaus oder die Praxis erfolgreich bekniet hat, ihre Daten auf einem geeigneten Medium herauszugeben, stellt sich die Frage, wie sie sie von da an verwalten will. Möchte sie den USB-Stick zu Hause ins Regal legen, so wie sie es mit einer papiernen Patientenakte getan hätte? Das geht, wird aber mit zunehmendem Fortschritt der Wissenschaft irgendwann unbefriedigend – umso mehr, je mehr potenziell nützliche Erkenntnisse man aus den Daten ziehen könnte, wenn man sie mit anderen Daten in Verbindung bringen würde.
Also: Die elektronische Patientenakte muss her.
Diese sollte aber, gerade wegen der Aussagefähigkeit dieser persönlichen Daten, nicht in falsche Hände geraten. Im Zweifelsfall also in den Händen – und vollständig unter der Kontrolle – der Patientin bleiben. Das bringt ein paar logistische Probleme mit sich: Die Verschlüsselungsverfahren, um das umzusetzen, gibt es schon, sind aber notorisch für ihre mangelnde Benutzerfreundlichkeit.
Ist die Blockchain vielleicht in Schritt in die richtige Richtung? Nicht jede Blockchain, und nicht für jede Anwendung – mehr dazu demnächst hier im Blog!
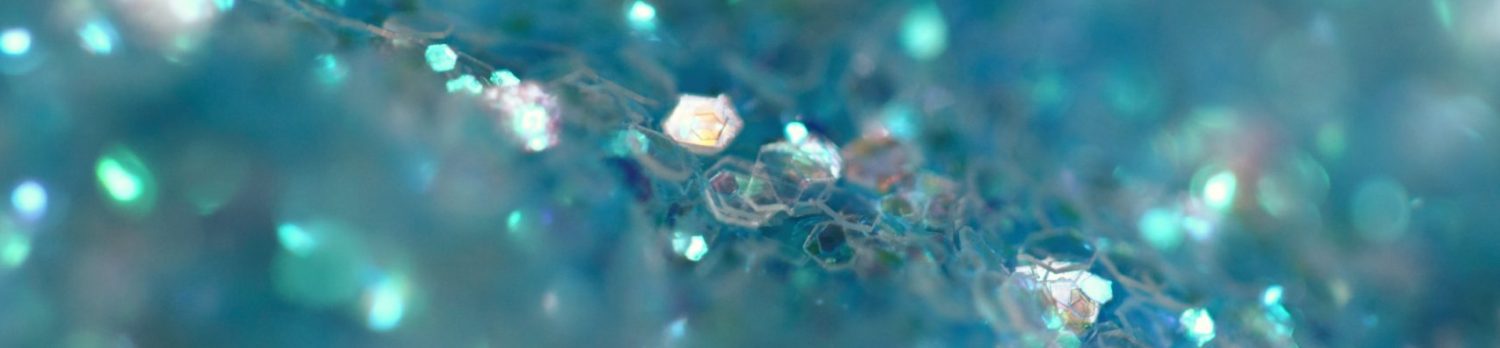



1 Trackback / Pingback
Comments are closed.