I’m not a magician, I’m just an old country doctor.
Und trotzdem hatte McCoy, der „alte Landarzt“ des Raumschiffs Enterprise, nicht ganz üble Technologie zur Verfügung.
Auftritt: Der Tricorder.
Was McCoy und seine Nachfolger damit nicht alles machen konnten: Von einer kompletten Herz-Kreislauf-Diagnostik über die Abklärung rätselhafter Kopfschmerzen bis hin zu blöden Witzen – und zwischen verschiedenen irdischen und außerirdischen Lebensformen unterscheiden natürlich auch. Eine Besonderheit des medizinischen Tricorders, im Gegensatz zu den „gewöhnlichen“ Tricordern, die als die Schweizer Taschenmesser der Außenmissionen funigerten: Ein kleiner, drahtloser Sensor, der direkt über die Körperbereiche geführt werden konnte, die die Neugier des Doktors geweckt hatten.
Während wir die Technik von Star Trek schon in manchen Aspekten überholt haben, hat sich der Traum vom medizinischen Tricorder bisher nicht erfüllt. Was nicht daran liegt, das zu wenig Leute davon träumen: Seit Jahren schon geistern immer wieder Meldungen durch die Presse, denen zufolge ein Startup nun endlich den medizinischen Tricorder auf den Markt bringen würde.
Eins der ersten auf dem Markt war das Silicon-Valley-Startup Scanadu, das 2013 nach eigenen Angaben auf Indiegogo 1,6 Millionen Dollar für sein Produkt, den Scanadu Scout, gesammelt hat. Der Scout ist ein kleines Device, das mit Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden kann. Die Sensorseite des Scout wird auf die Stirn gedrückt und misst Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur und Sauerstoffsättigung des Blutes.
Der Scanadu Scout wird zur Zeit nicht mehr ausgeliefert, sondern im Rahmen einer Studie – zu der die Scanadu-Webseite nichts näheres verrät – untersucht, wohl mit den bisherigen Bestellern als Probanden. Ein auf der Webseite verlinktes Tutorial-Video zur Anwendung des Scanadu Scout ist nicht mehr online.
Der Doku auf der Webseite zufolge arbeitet der Scout mit zwei Sensoren: Einem optischen zur Pulswellenmessung und einem Infrarotsensor zur Temperaturmessung. Dementsprechend sind die Einsichten, die einem das kleine Gerät verschaffen kann, auch eher begrenzt: Blutdruck, Herzfrequenz und Temperatur kann man mit Geräten messen, die jede Oma im Badezimmerschrank hat. Die Sauerstoffsättigung des Blutes lässt sich ebenfalls mit relativ geringem Aufwand messen – das Verfahren heißt Pulsoximetrie.
Die Pulsoximetrie beruht darauf, dass Hämoglobin – das Molekül in unserem Blut, das den Sauerstoff transportiert – bei unterschiedlich hoher Sauerstoffsättigung verschiedene Wellenlängen von Licht absorbiert. Einfache Pulsoximeter bestehen aus zwei LEDs: einer roten und einer infraroten. Man benötigt dafür eine Körperstelle, die gut vom Licht durchschienen werden kann, wie etwa Ohrläppchen oder Fingerkuppe. Wenn das Hämoglobin in den kleinen Gefäßen (Kapillaren) der Fingerkuppe viel Sauerstoff trägt, also „oxygeniert“ ist, dann wird mehr Infrarotlicht absorbiert und mehr sichtbares rotes Licht durchgelassen. Wenn das Hämoglobin wenig Sauerstoff trägt, also „desoxygeniert“ ist, dann ist es umgekehrt. Mittlerweile gibt es sogar Smartphone-Apps, die die Sauerstoffsättigung messen, denn moderne Smartphones sind normalerweise auch mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet.
Aber was sagt uns unsere Sauerstoffsättigung nun über unseren Gesundheitszustand? Nicht viel. Die normale Sauerstoffsättigung in den Kapillaren liegt zwischen 95 und 100%. Es gibt kaum unerkannte Krankheiten, die man rein zufällig durch die Messung einer erniedrigten Sauerstoffsättigung von unter 90% entdecken könnte – wenn man eine Lungenkrankheit hat, merkt man das in der Regel nicht erst durch die Pulsoxymetrie auf dem Handy. Eine Ausnahme wäre vielleicht die Schlafapnoe, also Atemaussetzer durch kollabierende Luftwege im Schlaf. Jemand, der hiervon betroffen ist, merkt oft nur eine unerklärliche Müdigkeit tagsüber. Ein nächtliche Messung könnte hier tatsächlich eine deutlich erniedrigte Sauerstoffsättigung zeigen.
Das ist aber auch so ziemlich der einzige häusliche Anwendungsfall. Nicht mal zur Erkennung einer versehentlichen CO-Vergiftung (Gastherme, verstopfter Kamin) taugt ein einfaches Pulsoxymeter, da es nicht zwischen an Hämoglobin gebundenem Sauerstoff (O2) und CO (Kohlenmonoxid) unterscheiden kann (das können nur teurere Geräte, die in der Regel in Kliniken stehen).
Und abgesehen vom eingeschränkten Funktionszustand ist auch sonst bei Scanadu nicht alles Gold, was glänzt: Im Blog werden zwar feurige Plädoyers zum Recht der Patienten auf ihre eigenen Daten gehalten, aber als Nutzer seine eigenen Rohdaten herunterladen? Das erlaubt Scanadu nicht („not at this time“). Auf sozialen Netzwerken dagegen darf man seine Vitaldaten nach Herzenslust teilen.
Fazit: Nicht mal unter Einfluss von reichlich Romulanischem Ale könnte man dieses frühe Modell mit einem echten medizinischen Tricorder verwechseln. Aber der Scanadu Scout ist nicht der letzte seiner Art: Weiter geht es hier nächste Woche mit der nächsten Folge in der Reihe „Medizinische Tricorder: Science oder Fiction?“ und einer Bauchlandung von Google.
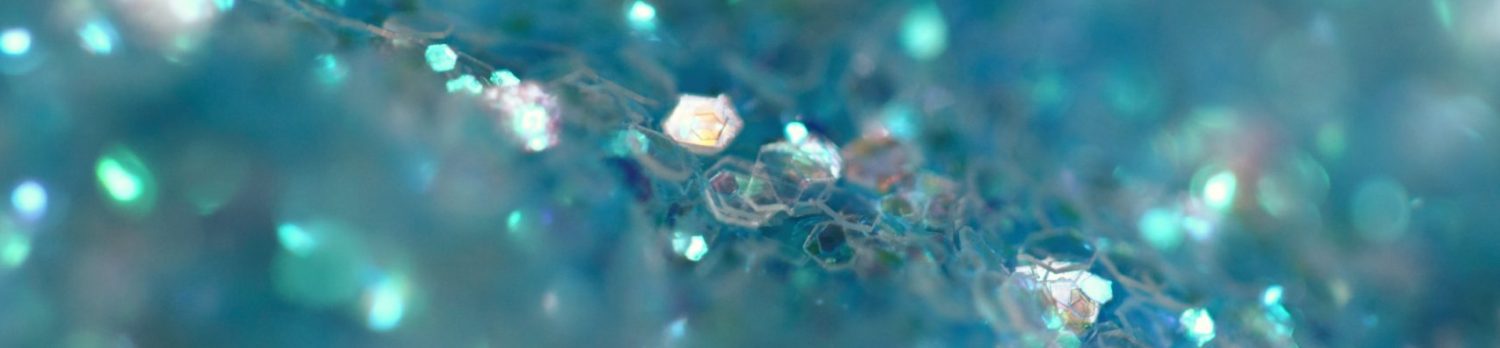



2 Trackbacks / Pingbacks